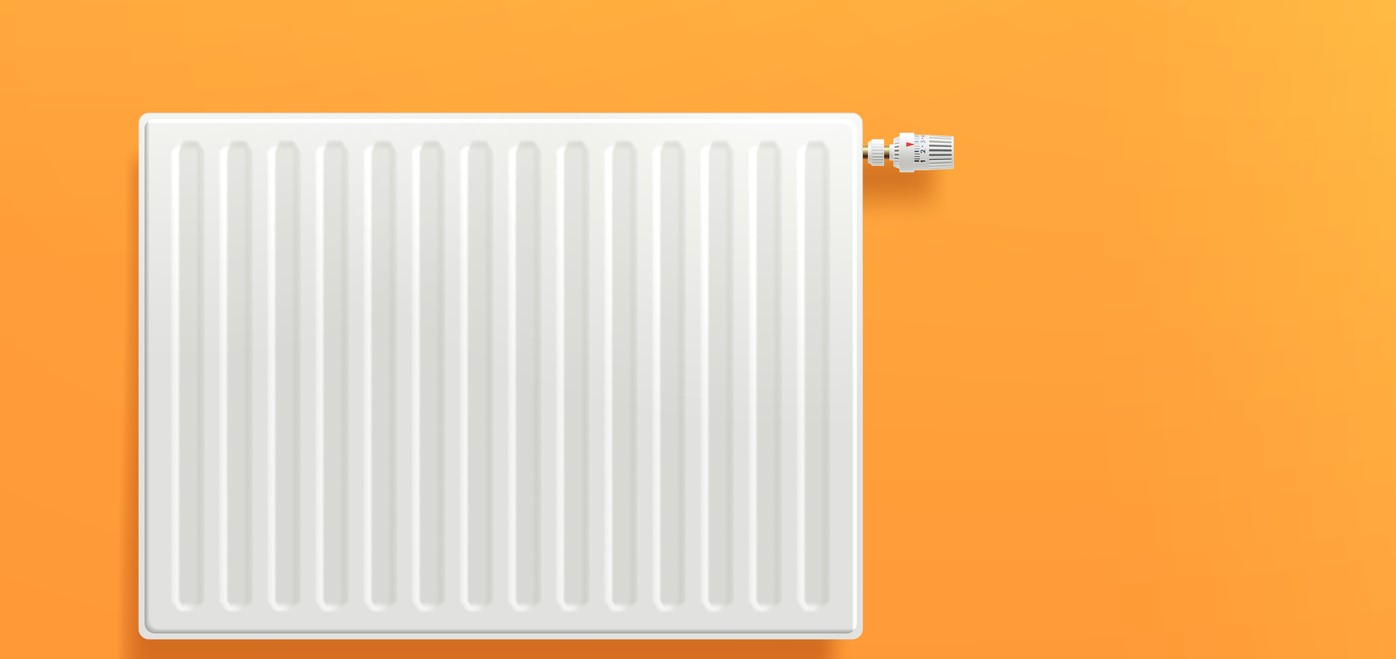Heizungstechnik – Informationen zu Wärmeabgabe, Heizkörpern und Co.
Hier können Sie sich über Wärmeabgabe, Heizkörper-Techniken, Details zu Heizungsregelungen, Wärmespeicher und vieles mehr detailliert informieren.
Die verschiedenen Formen der Wärmeabgabe
Manche Heizflächen verteilen die Wärme mit der Bewegung der Luft (Konvektion). Je heißer die Heizfläche ist, desto mehr Konvektion entsteht.
Andere Heizflächen geben vor allem Wärmestrahlen ab, die in Wärme umgewandelt werden, wenn sie auf Gegenstände oder Menschen treffen. Diese Strahlungswärme, wie wir sie von der Sonne kennen, schafft ein angenehmes Raumklima.
Wieviel Wärme abgestrahlt und wieviel über die Luft abgegeben wird, hängt von der Heizfläche ab. Mit der Größe der Heizfläche erhöht sich automatisch auch der Strahlungsanteil. Außerdem muss die Heizfläche nicht so stark erwärmt werden. Wir fühlen uns wohler, wenn Raumluft und Oberflächen eine ähnliche Temperatur haben. Dann reicht auch eine geringere Raumlufttemperatur für hohen Komfort.
Je weniger Wärme über die Gebäudehülle verloren geht, desto einfacher lässt sich der Strahlungsanteil erhöhen. Effiziente Häuser brauchen nur wenig Wärme. Um die Räume zu erwärmen, reichen dann wenige bzw. kleine Heizflächen aus, die nur ein bisschen warm werden. Im Idealfall reichen schon 25 °C bis 30 °C. Damit werden die Heizflächen kaum wärmer als die Raumtemperatur.
Heizkörper
Früher wurden Heizkörper häufig in Nischen unter dem Fenster eingebaut und zur Dekoration abgedeckt. Damit sollten die Energieverluste der oft undichten Fenster ausgeglichen werden. Am Fenster kühlt die Luft ab und sinkt nach unten, dort trifft sie auf den Heizkörper und wird wieder erwärmt. So wird verhindert, dass sich kalte Luft am Boden sammelt.
Bei modernen 3-Scheiben-Fenstern ist das nicht mehr nötig. Heizflächen können dann unabhängig von Fenstern im Raum platziert werden. Egal wo sich die Heizkörper befinden, sie sollten möglichst frei und ohne Abdeckungen stehen.
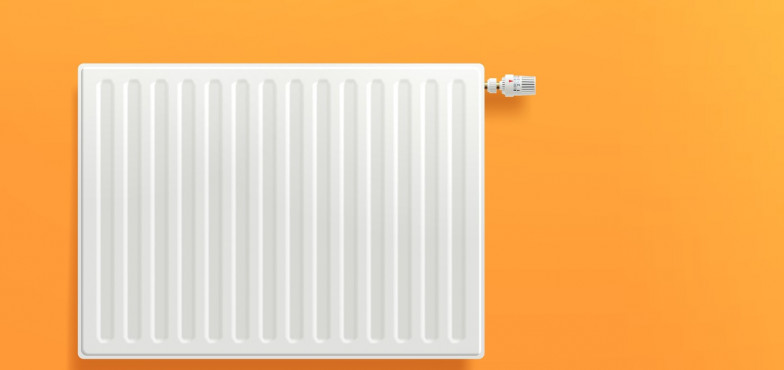
- Flachheizkörper bestehen aus glatten, wasserdurchströmten Blechen. Die glatte Vorderseite strahlt die Wärme in den Raum ab. Eingebaute Konvektorbleche geben die Wärme an die Luft ab, so dass diese nach oben in den Raum strömt (Konvektion). Abhängig von der Bauform (ein, zwei, oder drei Platten hintereinander) liegt der der Strahlungsanteil zwischen 70 % und 30 %. Großzügig ausgelegte Flachheizkörper können mit vergleichsweise niedrigen Vorlauftemperaturn betrieben werden.
- Gebläseunterstützte Niedertemperaturheizkörper sorgen für eine Luftströmung an der Metalloberfläche der Heizkörper. Dadurch wird die Wärmeübertragung verbessert und die Vorlauftemperatur der Heizung kann gesenkt werden, während die Wärmeabgabe an den Raum gleich bleibt. Dies ist insbesondere beim Betrieb von Wärmepumpen sehr vorteilhaft, denn je geringer die Vorlauftemperatur im Heizkreis, desto höher ist die Effizienz der Wärmepumpe. Ältere Heizkörper können mit passenden Ventilatoreinheiten nachgerüstet werden. Einzige Voraussetzung ist ein Stromanschluss. Das Gebläse hat üblicherweise eine geringe Leistung von etwa 0,4 Watt pro Ventilator und funktioniert geräuscharm.
- Konvektoren verteilen die Wärme ausschließlich mit der Luft. Konvektoren werden oft in Bodenvertiefungen vor Fenstern oder als Sockelleiste an den Außenwänden angebracht. Kalte Luft strömt am Boden zum Konvektor. Dort wird die Luft aufgeheizt und strömt nach oben. Dabei bildet sich ein Warmluftschleier vor dem Fenster oder der Wand. In einer großen Luftwalze verteilt sich die warme Luft entlang der Decke und fällt langsam wieder Richtung Boden. Konvektoren benötigen wenig Platz und können schnell geregelt werden. Da die Wärmeverteilung über die Luftbewegung erfolgt, wird allerdings Staub aufgewirbelt.
Flächenheizungen
Das Heizungswasser muss bei den meisten Heizkörpern relativ heiß sein. Deswegen eignen sie sich meist nicht für Wärmepumpen und Heizsysteme mit Solarthermieanlage. Für den Niedertemperaturbereich gibt es spezielle Heizkörper.
Flächenheizungen sind auf geringe Vorlauftemperaturen ausgelegt und werden vor allem in Neubauten eingesetzt. Flächenheizungen benötigen keinen Platz im Raum und strahlen die Wärme überwiegend ab. Sie können allein aber auch zusammen mit Heizkörpern verwendet werden. Die meisten Flächenheizungen reagieren nur träge und können nicht schnell geregelt werden. Je nach Heizsystem können Wand- und Deckenheizungen im Sommer zur Kühlung von Räumen verwendet werden.
- Fußbodenheizungen sind am weitesten verbreitet. Meist werden dafür Kunststoffrohre auf der Trittschalldämmung in bestimmten Abständen ausgelegt und in den Estrich eingegossen (Nassverlegung). Die Rohre bestehen aus einem speziellen Kunststoff.
Die Heizungsrohre können auch trocken verlegt werden. Sie werden dann mit Abdeckblechen bedeckt und können beispielsweise mit Trockenestrichplatten oder Parkett belegt werden.
Gut eignen sich für die Abdeckung von Fußbodenheizungen Materialien, die die Wärme gut weitergeben, wie beispielsweise Fliesen oder Naturstein. Teppiche verzögern die Wärmeabgabe. - Bei Wandflächenheizungen werden oft Kunststoff- oder Kupferrohre an der Rohbauwand befestigt und mit Putz überdeckt (Nassverlegung). Es gibt auch Lehm- oder Gipsplatten, in die bereits Rohre eingelegt sind. Sie können bei der Trockenverlegung direkt verbaut werden. Wandheizungen sollten, wie alle Heizflächen, nicht mit Möbeln verstellt werden.
- Deckenheizungen werden unter die tragende Decke gehängt. Auch hier gibt es verschiedenste Lösungen, um Kupfer- oder Kunststoffrohre anzubringen und zu verkleiden. So gibt es fertige Platten, in die bereits Rohre eingelegt sind, oder die Rohre werden nachträglich mit Platten überdeckt. Dies kann eine Sichtholzdecke sein oder Abdeckplatten aus Gipskarton. Die Platten können wie alle anderen Decken verputzt, gestrichen und tapeziert werden. Deckenheizungen haben den Vorteil, dass sie nicht von Möbeln oder Teppichen verdeckt werden können.
- Betondecken eignen sich zur thermischen Bauteilaktivierung. Dabei werden Kunststoffrohre in der Betondecke einbetoniert. Sie geben die Wärme je nach Konstruktion langsam nach oben oder unten in die Räume ab. Wenn sowieso Betondecken verbaut werden, ist die Bauteilaktivierung relativ kostengünstig, da keine weiteren Bauteile benötigt werden. Die Bauteilaktivierung kann im Sommer auch zur Gebäudekühlung verwendet werden.
Heizungsregelung
In den 1960er Jahren wurden Heizungen mit konstanten Kesseltemperaturen und Umwälzpumpen im Dauerbetrieb verbaut, was sehr ineffizient war. Mittlerweile gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Heizung so zu regeln, dass sie nur so viel Wärme wie nötig erzeugt und damit weniger Brennstoff bzw. Strom zum Einsatz kommt. Das spart Energie, ohne an Behaglichkeit einzubüßen.
Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) schreibt eine regelbare Heizung vor. Dabei versorgt ein vollautomatisches Heizungssystem das Haus mit Wärme und ein geregelter Wärmeerzeuger bzw. Kessel passt die Temperatur des Heizungswassers gleitend an den aktuellen Bedarf an.
Die Steuerung des Kessels stellt die Vorlauftemperatur für das gesamte Heizsystem ein. Mit den Thermostatventilen an den Heizkörpern kann die Wärme für die einzelnen Räume individuell geregelt werden.
- Bei der Außentemperaturregelung wird die Heizleistung an die Umgebungstemperatur angepasst. Je wärmer es außen ist, desto niedriger ist die Vorlauftemperatur. Die Außentemperaturregelung ist heute bei neuen Anlagen Stand der Technik. In einem sehr effizienten Haus, wie einem Passivhaus, hat die Außentemperatur einen deutlich geringeren Einfluss auf die Innentemperatur. Deswegen ist diese Regelung in diesem Fall nicht notwendig.
- Bei der Innentemperaturregelung hängt die Vorlauftemperatur davon ab, wie warm es in den Räumen ist. Dafür wird ein Temperatursensor in einem Raum, meist im Wohnzimmer, angebracht. Diese Regelung wird oft bei Gasetagenheizungen verwendet. In herkömmlichen Gebäuden kann Sie allerdings Schwierigkeiten verursachen. Wenn das Wohnzimmer ausreichend warm ist, schaltet die Heizung ab, egal ob die anderen Räume ausreichend warm sind. Abhilfe schaffen hier Regelungen, die in allen Räumen elektrische Thermostate verbaut haben, die auf die Heizung Einfluss nehmen können. In Gebäuden mit sehr hoher Effizienz, wie Passivhäusern, kann diese Regelung dennoch ausreichend sein. Auch in kleinen Wohnungen oder bei offenen Grundrissen kann diese Regelung funktionieren.
- Eine Rücklauftemperaturregelung optimiert den Heizungsbetrieb in Abhängigkeit der im Gebäude benötigten Wärme. Im Gegensatz zur Außentemperaturregelung kann sie auf Wärmegewinne und beispielswiese Lüftungswärmeverluste im Gebäude reagieren. Steigt die Temperatur des zur Heizung zurückfließenden Wassers (Rücklauf), weil weniger Wärme in die Räume abgegeben wird, reduziert die Regelung die Vorlauftemperatur und liefert nur so viel Energie wie notwendig.
Mit Holz, Öl oder Gas betriebene Einzelraumheizungen saugen die notwendige Zuluft in der Regel aus dem Raum, in dem sie aufgestellt sind. Vor allem wenn solche raumluftabhängigen Öfen gleichzeitig mit einer Lüftungsanlage oder einer Ablufthaube am Herd betrieben und der Kessel dabei nicht ausreichend mit Luft versorgt wird, kommt es zu einem Unterdruck im Gebäude. Dieser Unterdruck verhindert, dass die Rauchgase nach außen geleitet werden. Das kann gesundheitliche Folgen für die Bewohner haben und ohne Schutzeinrichtung lebensgefährlich werden. Aus diesem Grund werden raumluftabhängige Kessel zusammen mit Lüftungsanlagen nur zugelassen, wenn entsprechende Schutzeinrichtungen vorhanden sind. Beispielsweise wenn ausreichend Luftzufuhr durch eine Lüftungsöffnung gesichert ist oder bei Unterdruck die Lüftung oder der raumluftabhängige Kessel automatisch abschalten. Bei Ablufthauben kann ein Fensterkontaktschalter dafür sorgen, dass die Dunstabzugshaube nur läuft, wenn das Fenster gekippt ist.
Wird ein raumluftabhängiger Kessel zusammen mit einer Lüftungsanlage bzw. Dunstabzugshaube betrieben, sollten Sie die Schornsteinfegerin bzw. den Heizungsinstallateur rechtzeitig mit einbeziehen.
Wärmespeicher
Im Gegensatz zu den früher verbreiteten Wasserspeichern, bei denen das gespeicherte Wasser direkt verwendet wurde, sind heute Pufferspeicher in Verbindung mit einer Trinkwasserstation Stand der Technik. Der Pufferspeicher – ein mit Wasser gefüllter Stahlbehälter – hat die Funktion, die Wärme zu speichern. Bedarfsgerecht wird daraus Wärme für die Heizflächen sowie die Trinkwarmwasserbereitung entnommen. Pufferspeicher können von verschiedenen Wärmequellen beladen werden. Ideal sind Schichtladespeicher. Das sind Pufferspeicher, die das Wasser entsprechend seiner Temperatur in den Speicher einschichten.
Die Warmwasserbereitstellung erfolgt effizient mit Hilfe einer Frischwasserstation. Dabei gibt das Wasser im Pufferspeicher einen Teil seiner Wärme über einen externen Wärmeübertrager (Plattenwärmetauscher) an das Trinkwasser ab. Das Trinkwasser wird mit dem Prinzip des Durchlauferhitzers bedarfsgerecht und sehr energieeffizient erwärmt. Ein großer Vorteil besteht darin, dass die Anforderungen an die Hygiene schon bei einer Temperatur von 45 °C erfüllt werden. Frischwasserstationen werden immer häufiger eingesetzt, vor allem, weil sich darin keine Legionellen vermehren können. So können Effizienz, Legionellenschutz, Kalkschutz und Verbrühungsschutz optimal vereint werden.
Bei älteren Speichern führt das Rohr, mit dem warmes Wasser aus dem Speicher entnommen wird, manchmal senkrecht nach oben. Warmes Wasser steigt aufgrund der Dichteunterschiede in das Rohr, auch wenn es keine Entnahme gibt. Dort kühlt es ab und fließt innerhalb des Rohres zurück in den Speicher, wodurch die Schichtung verändert wird. Um das zu verhindern, kann ein Thermosiphon eingebaut werden. Die Leitung führt zuerst aufwärts, wird dann über ein kurzes Stück abgesenkt und steigt anschließend weiter auf. Das warme Wasser kann nur bis zur Absenkung in das Rohr steigen und die Verluste werden verringert.
Fazit
Für die technische Optimierung Ihrer Heizung gibt es keine Pauschallösung. Lassen Sie sich beraten, welche Maßnahmen bei Ihnen vor Ort zum besten Ergebnis führen. Erkundigen Sie sich auch, ob es für die Übernahme der Beratungskosten geeignete Förderprogramme gibt. Hilfe erhalten Sie bei Mitgliedern des Fachverbands für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Bayern(Link öffnet in einem neuen Fenster).