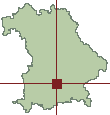"Windheizung 2.0“ als eine innovative Strom-Heizung (Power-to-Heat)
Mit dem innovativen Speicherkonzept „Windheizung 2.0“ können Gebäude künftig ihren Energiebedarf klimafreundlich und flexibel decken und aktiv zur Energiewende beitragen.
Galerie
Beschreibung
Auslöser
Der seit über 20 Jahren im Bereich der energetischen Sanierung tätige Architekt Dipl.-Ing. Thomas Schilling wollte nach längerem Planungsvorlauf sein 2014 erworbenes Wohnhaus, eine sich weitgehend im Originalzustand befindliche gutbürgerliche Doppelhaushälfte (BJ 1921) in der damaligen Villenkolonie Menterschwaige der damals über München hinaus bekannten Baufirma Heilmann & Littmann, beispielhaft energetisch sanieren. Die Kombination mit dem Projekt Windheizung 2.0 war eine ideale Ergänzung.
Durchführung
Das Gebäude mit ca. 40 cm starken Betonwänden im Untergeschoss und 38 cm starken Vollziegelwänden in den beiden oberen Etagen samt ungedämmtem Dachboden wurde 2022-2024 umfassend saniert, das Dach erneuert und ein gartenseitiger Anbau in Holzbauweise errichtet. Das Gebäude entspricht nun einem Effizienzhaus 40 EE.
Der Kellerboden wurde tiefergelegt und von unten mit 20 cm gedämmt, die Keller und die Außenwände erhielten 20-24 cm Außendämmung, ein Fassadenteil wurde mit einer nach historischer Vorlage geplanten profilierten und hinterlüfteten Holzfassade ausgeführt. Die Kastenfenster wurden gegen dreifach-verglaste Holzfenster mit historischen Profilen ausgetauscht und in den meisten Fällen vergrößert, die ursprüngliche Haustüre durch ein nach historischer Vorlage gefertigtes Türelement ersetzt. Dach und Wintergarten erhielten Dämmstärken von ca. 30 cm. Sämtliche Wärmebrücken wurden im Detail geplant und optimiert, so dass trotz der Altbau- und Doppelhaussituation ein Wärmebrückenzuschlag von nur 0,02 W/m²K möglich war.
Die Ölheizung mit Radiatoren wurde durch eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 1.000 Liter Pufferspeicher mit Frischwassermodul und Wärmeverteilung über eine Bauteilaktivierung der Außenwände mit Verlegung der Heizleitungen unterhalb der Außendämmung ersetzt. Im Keller wurde eine Bauteilaktivierung in den gedämmten und ca. 14 cm starken Betonboden/Estrich eingebaut. Im Dach gibt es eine Flächenheizung in den mit 30 mm starken Lehmplatten verkleideten Dachschrägen und der Trennwand. Der ca. 18 m² große Wintergarten erhielt eine konventionelle Fußbodenheizung. Die Vorlauftemperaturen liegen aufgrund der engen Leitungsabstände und der guten Dämmung und geringer Lüftungswärmeverluste selbst bei Außentemperaturen von -15°C bei lediglich 32°C.
Aufgrund der hohen Speichermasse in den Außenwänden und im Kellerboden ist eine schnelle Temperaturregelung nicht möglich. Stärkere Temperaturschwankungen treten jedoch auch im Winter aufgrund der sehr guten Dämmung und geringer Lüftungswärmeverluste nicht auf. Die Wärmepumpe mit 12 kW wird im Winter durch einen wassergeführten Holzofen mit 15 kW und einer raumseitigen Wärmeabgabe von ca. 30% unterstützt, wodurch bei Bedarf die Temperatur im Wohnbereich etwas angehoben werden kann und darüber hinaus ein erheblicher Teil der Warmwasserbereitung sichergestellt wird. Weiter wurde eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Erdreichwärmetauscher und Leitungsführung innerhalb der Außenwände installiert.
Auf dem Dach befindet sich eine Photovoltaikanlage mit unauffälligen Solarziegeln, 12 kWPeak und 12 kWh Batteriespeicher. Solarerträge und Wärmepumpe sind über Smarthome gekoppelt, nachts ist die Wärmepumpe grundsätzlich deaktiviert. Während der Testphase der Windheizung 2.0 soll die installierte Wärmepumpe lediglich als Backup für die Raumbeheizung und das Warmwasser zur Verfügung stehen. Unterhalb der neuen Terrasse vor dem Wintergarten gibt es einen unbeheizten Raum für Gartengeräte, der nun für den Hochtemperatur-Steinspeicher der Windheizung 2.0 genutzt wird.
Bei der Windheizung 2.0 handelt es sich um eine Direktstrom-Heizung, die sich dem dynamischen Angebot im Stromnetz anpassen soll. Das Heizsystem ist auf den Einsatz in hocheffizienten und sparsamen Gebäuden zugeschnitten, die die Wärme besonders lang halten können. Das Prinzip ist einfach: Bei Stromüberschuss wird dem Netz Strom entnommen, in Wärme umgewandelt und im Gebäude gespeichert. Dafür stehen drei Möglichkeiten zur Verfügung: ein großer Wasserspeicher, Bauteilaktivierung in den Gebäudedecken und -wänden oder ein spezieller Hochtemperatur-Steinspeicher, so wie in diesem Gebäude. Ist hingegen das Angebot an Strom aus erneuerbaren Energien oder die Leitungskapazität knapp, wird kein Heizstrom entnommen. Der Hochtemperatur-Steinspeicher kann bis 800°C aufgeheizt werden, lädt über einen Wärmetauscher den Pufferspeicher auf bis zu 85°C und gibt zusätzlich Wärme über die Lüftungsanlage an das Gebäude ab.
Der Kellerboden wurde tiefergelegt und von unten mit 20 cm gedämmt, die Keller und die Außenwände erhielten 20-24 cm Außendämmung, ein Fassadenteil wurde mit einer nach historischer Vorlage geplanten profilierten und hinterlüfteten Holzfassade ausgeführt. Die Kastenfenster wurden gegen dreifach-verglaste Holzfenster mit historischen Profilen ausgetauscht und in den meisten Fällen vergrößert, die ursprüngliche Haustüre durch ein nach historischer Vorlage gefertigtes Türelement ersetzt. Dach und Wintergarten erhielten Dämmstärken von ca. 30 cm. Sämtliche Wärmebrücken wurden im Detail geplant und optimiert, so dass trotz der Altbau- und Doppelhaussituation ein Wärmebrückenzuschlag von nur 0,02 W/m²K möglich war.
Die Ölheizung mit Radiatoren wurde durch eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 1.000 Liter Pufferspeicher mit Frischwassermodul und Wärmeverteilung über eine Bauteilaktivierung der Außenwände mit Verlegung der Heizleitungen unterhalb der Außendämmung ersetzt. Im Keller wurde eine Bauteilaktivierung in den gedämmten und ca. 14 cm starken Betonboden/Estrich eingebaut. Im Dach gibt es eine Flächenheizung in den mit 30 mm starken Lehmplatten verkleideten Dachschrägen und der Trennwand. Der ca. 18 m² große Wintergarten erhielt eine konventionelle Fußbodenheizung. Die Vorlauftemperaturen liegen aufgrund der engen Leitungsabstände und der guten Dämmung und geringer Lüftungswärmeverluste selbst bei Außentemperaturen von -15°C bei lediglich 32°C.
Aufgrund der hohen Speichermasse in den Außenwänden und im Kellerboden ist eine schnelle Temperaturregelung nicht möglich. Stärkere Temperaturschwankungen treten jedoch auch im Winter aufgrund der sehr guten Dämmung und geringer Lüftungswärmeverluste nicht auf. Die Wärmepumpe mit 12 kW wird im Winter durch einen wassergeführten Holzofen mit 15 kW und einer raumseitigen Wärmeabgabe von ca. 30% unterstützt, wodurch bei Bedarf die Temperatur im Wohnbereich etwas angehoben werden kann und darüber hinaus ein erheblicher Teil der Warmwasserbereitung sichergestellt wird. Weiter wurde eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Erdreichwärmetauscher und Leitungsführung innerhalb der Außenwände installiert.
Auf dem Dach befindet sich eine Photovoltaikanlage mit unauffälligen Solarziegeln, 12 kWPeak und 12 kWh Batteriespeicher. Solarerträge und Wärmepumpe sind über Smarthome gekoppelt, nachts ist die Wärmepumpe grundsätzlich deaktiviert. Während der Testphase der Windheizung 2.0 soll die installierte Wärmepumpe lediglich als Backup für die Raumbeheizung und das Warmwasser zur Verfügung stehen. Unterhalb der neuen Terrasse vor dem Wintergarten gibt es einen unbeheizten Raum für Gartengeräte, der nun für den Hochtemperatur-Steinspeicher der Windheizung 2.0 genutzt wird.
Bei der Windheizung 2.0 handelt es sich um eine Direktstrom-Heizung, die sich dem dynamischen Angebot im Stromnetz anpassen soll. Das Heizsystem ist auf den Einsatz in hocheffizienten und sparsamen Gebäuden zugeschnitten, die die Wärme besonders lang halten können. Das Prinzip ist einfach: Bei Stromüberschuss wird dem Netz Strom entnommen, in Wärme umgewandelt und im Gebäude gespeichert. Dafür stehen drei Möglichkeiten zur Verfügung: ein großer Wasserspeicher, Bauteilaktivierung in den Gebäudedecken und -wänden oder ein spezieller Hochtemperatur-Steinspeicher, so wie in diesem Gebäude. Ist hingegen das Angebot an Strom aus erneuerbaren Energien oder die Leitungskapazität knapp, wird kein Heizstrom entnommen. Der Hochtemperatur-Steinspeicher kann bis 800°C aufgeheizt werden, lädt über einen Wärmetauscher den Pufferspeicher auf bis zu 85°C und gibt zusätzlich Wärme über die Lüftungsanlage an das Gebäude ab.
Zitate
-
Es freut mich sehr, dieses Leuchtturmprojekt mit der heutigen Auszeichnung als Gestalter im Team Energiewende Bayern aufzunehmen (Herr Staatssekretär Tobias Gotthardt, StMWi).
Tipps
- Informieren Sie sich über Fördermöglichkeiten.
- Berücksichtigen Sie bei der Planung alle Schritte und das gesamte Gebäude. Planen Sie einen Zeitpuffer ein aufgrund Witterung oder Verfügbarkeit von Personal und Material.
Auszeichnungen
-
06/2025: Gestalter im Team Energiewende Bayern
verliehen von: StMWi
Beispiel gemeldet: 08/2025
zuletzt aktualisiert: 08/2025